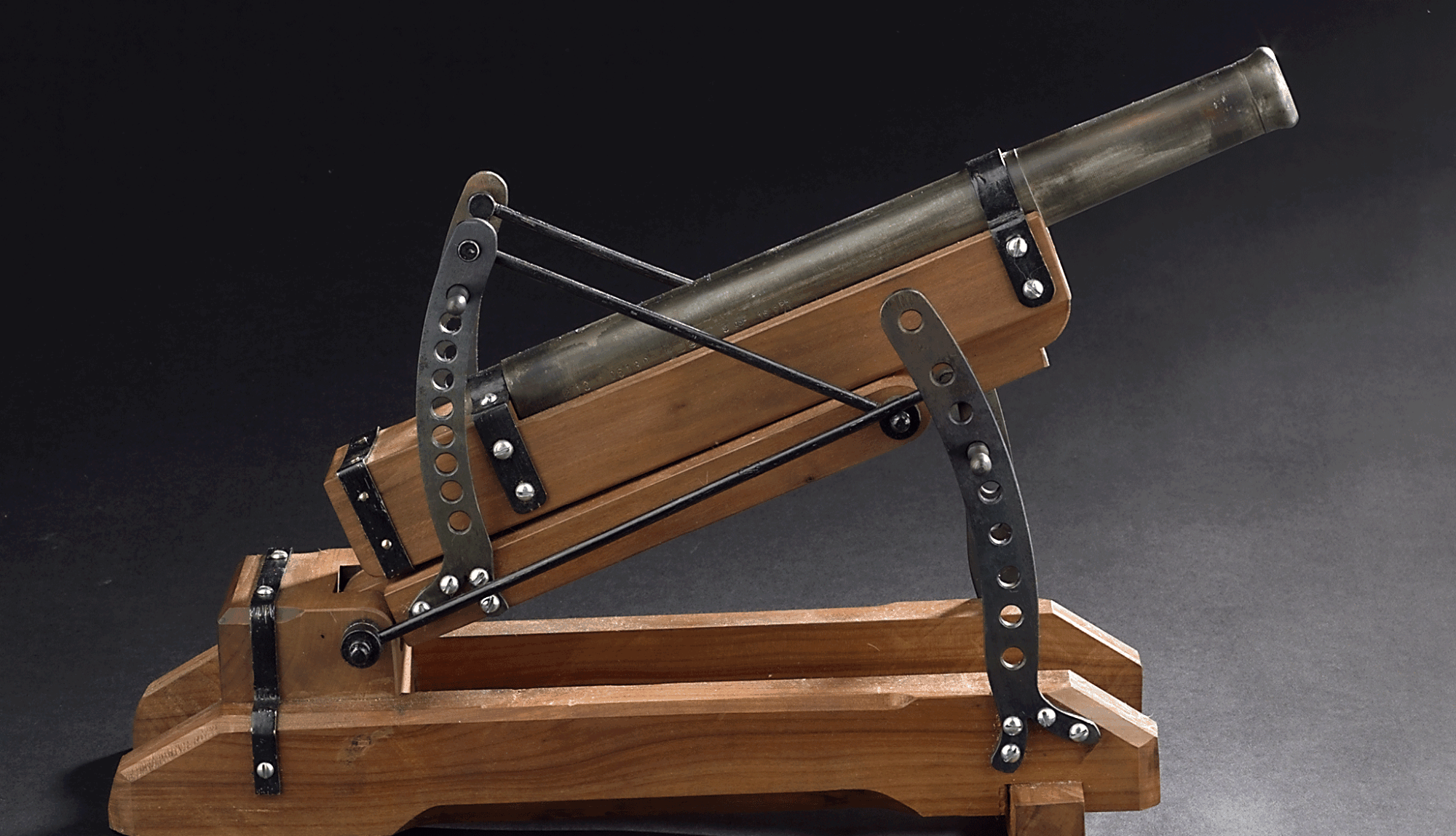|
ModelleNachbauten einiger Zeichnungen |
TarrasgeschützTarrasgeschütze kamen, wie der Name kündet, vor allem ortsfest auf Mauerkronen oder Wehrgängen zum Einsatz. Je großkalibriger und schwerer sie waren, um so wichtiger war stabile Lage und sichere Bettung. Bei größeren Stücken kamen fahrbare Lafetten nicht mehr in Betracht, da der Rückstoß beim Schuss sonst zu gefährlichen Situationen im beschränkten Platz der Wehrgänge hätte führen können. Auch auf flexible Seitenrichtung kam es weniger an, zumindest wenn an einem Mauerabschnitt mehrere Geschütze stationiert waren. Dafür mussten unterschiedlichste Schussdistanzen erreicht werden können. Sowohl Fernschüsse in gekrümmter Flugbahn für Angriffe auf weiter entfernte gegnerische Stellungen, Feldlager oder anmarschierende Truppen, als auch kurze, nach unten gerichtete Schüsse auf unmittelbar vor den Mauern anrvckende Truppen oder Kriegsgeräte mussten eingestellt werden können. Eines der Geschütze bei Philipp Mönch entspricht genau diesen Anforderungen. 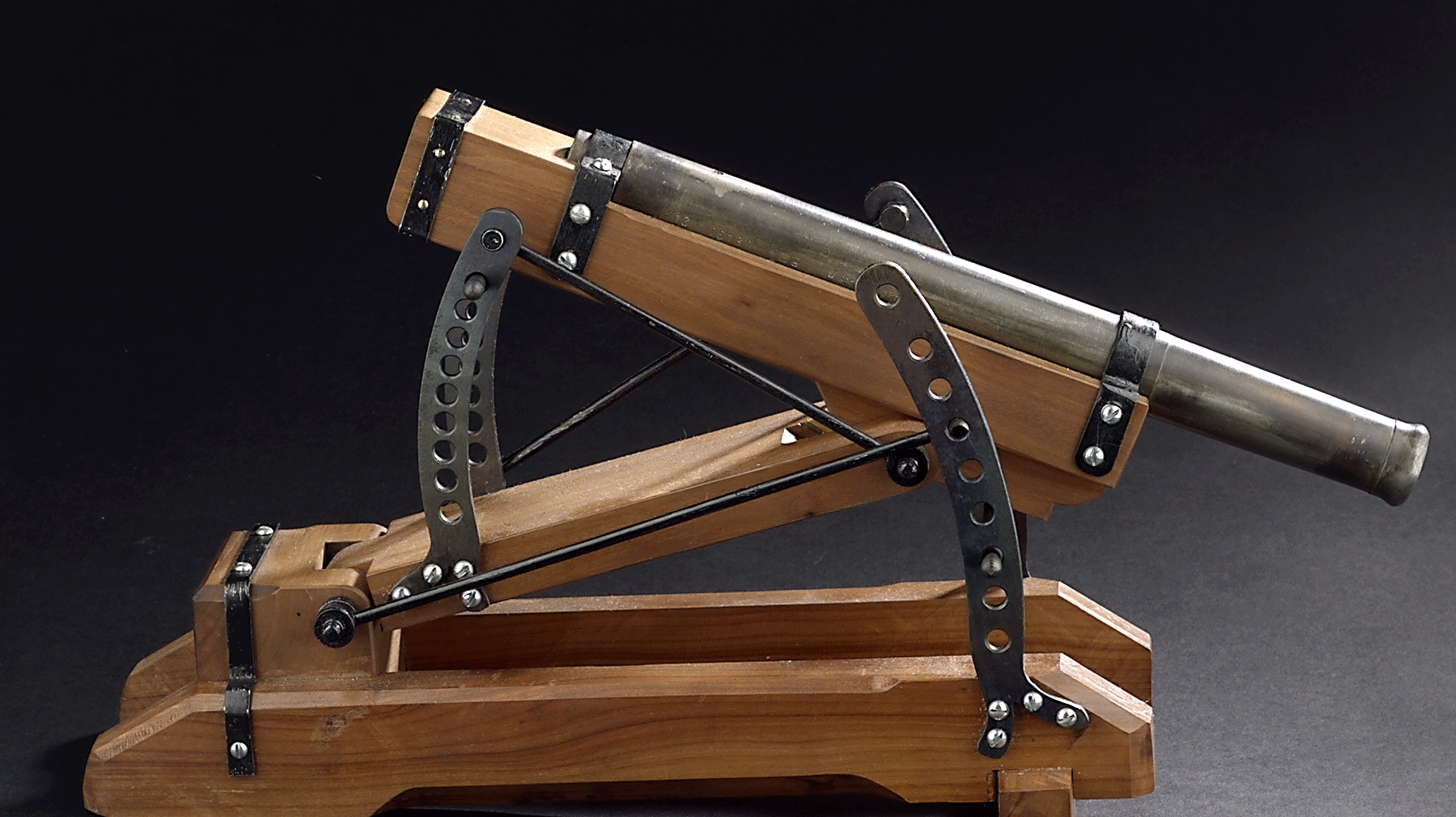 Das Geschütz ruht auf einer stabilen Bettung, die mit einem massiven Querträger zusätzlich gegen Kippen gesichert ist. Räder fehlen; auch Einrichtungen zum seitlichen Schwenken des Geschützes sind nicht zu erkennen. Dafür ist die Höhenrichtung außerordentlich flexibel. Durch Anheben des an der linken Vorderseite drehbar gelagerten unteren Lafettenschwanzes richtete sich die Büchse nach unten. Am rechten Arm der sog. Burgunderlafette konnte der untere Arm mit eingesteckten Zapfen fixiert werden. Am Ende der des untern Armes war wiederum ein drehbar gelagerter Arm angebracht, der das eigentliche Geschütz trug. Mit ihm konnte die Schussrichtung wiederum nach oben eingestellt werden. Auch hier erfolgte die Fixierung durch Zapfen in einer Burgunderlafette, die am unteren Arm angebracht war. Metallene Querstreben dienten der Versteifung der ganzen Aufhängung. In der modellhaften Rekonstruktion sind diese Elemente in ihrer Funktion noch deutlicher zu erkennen. Pulverstampfe
 Nachbau der Pulverstampfe Die im Kriegsbuch von Philipp Mönch abgebildete Pulverstampfe diente als Grundlage der Rekonstruktion. Neben diesem Werk aus dem Jahre 1496 gibt es nur noch die Handschrift WF328 (siehe Codex) in der Weimarer Bibliothek, in dem eine Abbildung eben dieser Pulverstampfe enthalten ist. Diese beiden Bilder waren die einzigen vorliegenden Abbildungen der zu rekonstruierenden Pulverstampfe. Ziel der Rekonstruktion war es, die Pulverstampfe sowohl möglichst originalgetreu nach Mönch nachzuempfinden, als auch ihre Funktionalität zu gewährleisten. Die Bilder ermöglichen lediglich eine Draufsicht auf die Pulverstampfe und verbergen somit die Antriebswelle, wie auch deren Lagerung. Beide Bilder lassen eine unterschiedliche Interpretation der Pulverstampfe zu, so dass eine weitere Recherche von Nöten war. Das Ergebnis stellt somit einen Kompromiss dar zwischen dem Studium zahlreicher Stampfen aus der Literatur, sowie der Sichtung anderer existierender Modelle und Rekonstruktionen. Die Funktionalität ist gewährleistet und optisch kommt die Pulverstampfe dem Entwurf von Mönch sehr nahe. In ihrer jetzigen Form ist die Pulverstampfe voll funktionsfähig. Mit einer Hubhöhe von ca. 13cm und dem Gewicht der einzelnen Stampfen ist sie in der Lage Kohle, Schwefel und Salpeter zu Pulver zu stampfen. Sicherlich gibt es andere und eventuell auch bessere Pulverstampfen als die von Mönch gezeichnete und hier umgesetzte. Die Rekonstruktion hat jedoch gezeigt, dass es möglich ist, auf diese Art und Weise Pulver herzustellen. Auch ließe sich diese Pulverstampfe durch kleine Modifikationen noch verbessern, was sich während der Erschließung der Literatur und den Bauphasen deutlich herausstellte. Beispielsweise könnte die Hubhöhe und das Gewicht der 8 Stampfen vergrößert, die Welle für einen dauerhaften Betrieb besser gelagert, die Anzahl der Hubbewegungen pro Umlauf erhöht und die Räder für mehr Schwung vergrößert werden. Teil der Zielerreichung war jedoch auch gerade Mönchs Pulverstampfe darzustellen, was mit der entstandenen Rekonstruktion gelungen ist. Kran
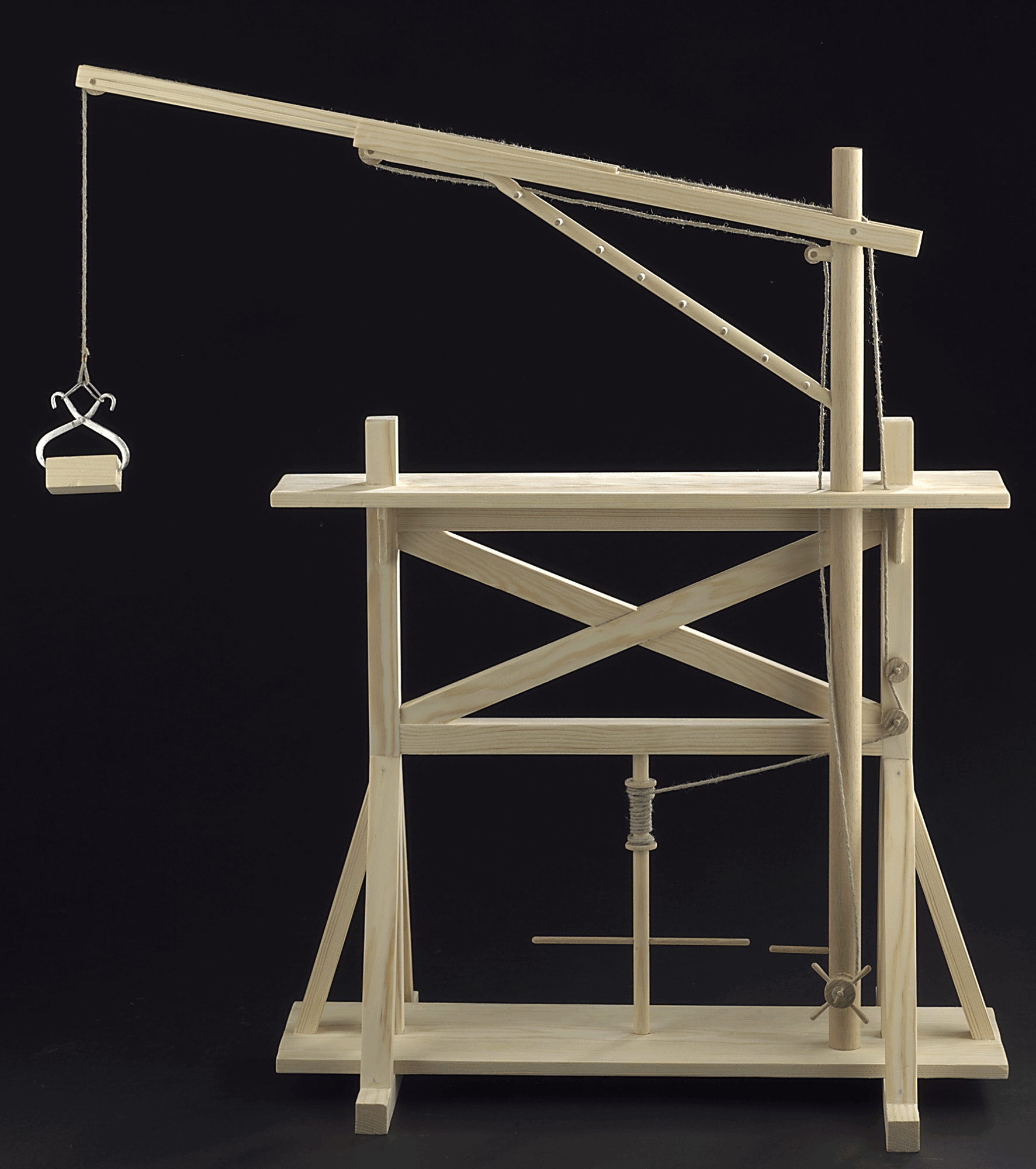 Nachbau eines Kranes 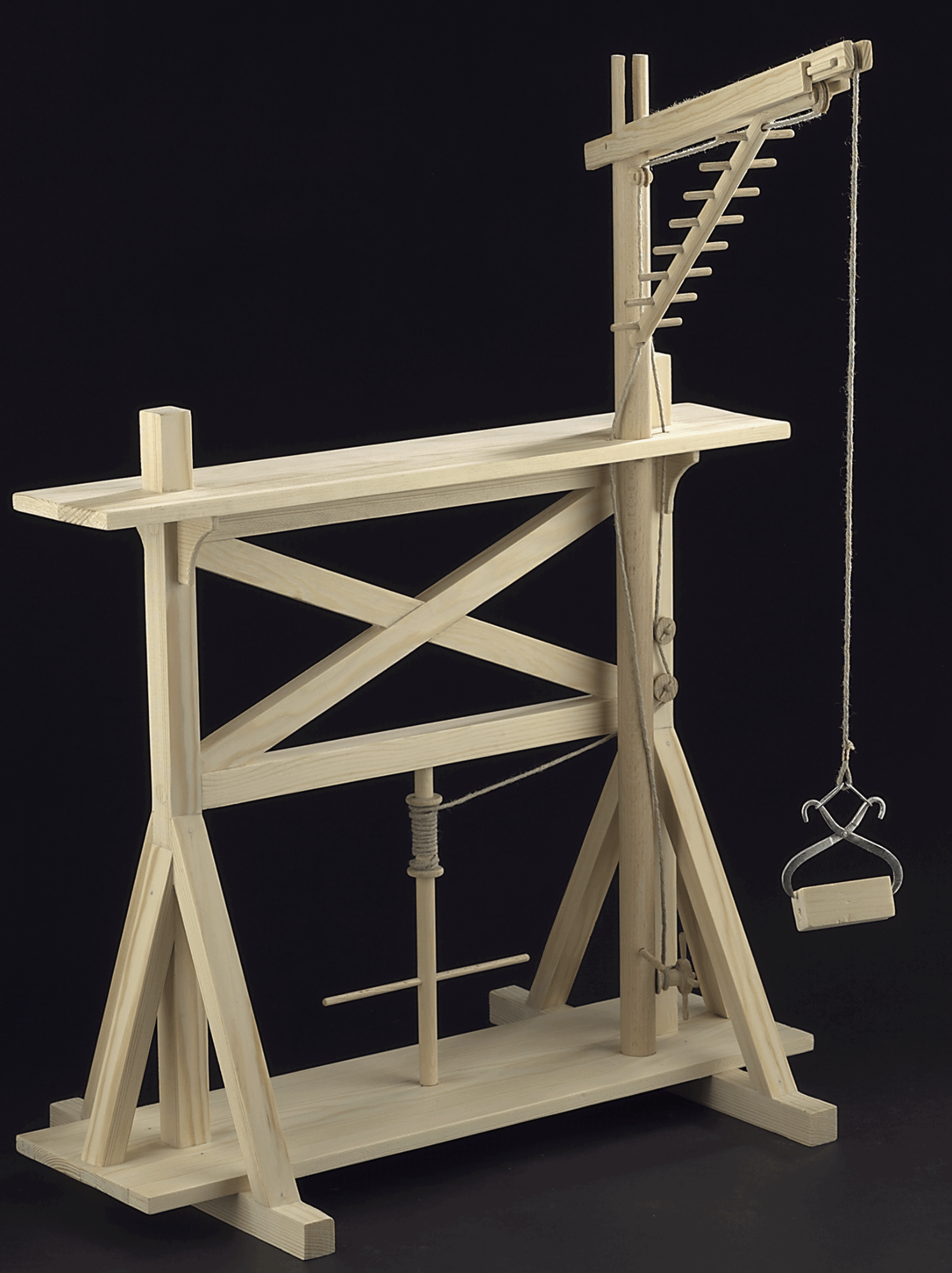 Als Windwerk wird bei den großen Kränen eine vertikale Welle dargestellt, die von zwei Menschen angetrieben wird. Die Konstruktion sollte das Heben von schweren Lasten erleichtern. Der Kran ist mit einer Greifzange ausgestattet, was bedeutet, dass er zum Heben von Quadern konstruiert wurde. Auf dem linken Bild ist noch eine Haspel an der Hauptsäule zu erkennen. Hierzu bieten sich zwei Erklärungsmöglichkeiten an. Sehr wahrscheinlich, dass der Autor damit auf eine weitere Antriebsmöglichkeit hinweisen wollte. Die Haspel konnte von einem Mann bedient werden und eignete sich gut zum Heben von leichten Baumaterialen. Andererseits mag es sein, dass der Ausleger eine kompliziertere Konstruktion aufwies. Ein Teil des Auslegers, das sich zwischen den großen Außenholmen befand, war beweglich und konnte durch das Betätigen der kleinen Haspel herausgefahren werden. Beim Entspannen des Zugseiles sollte dieses Teil wieder zurückgleiten oder es wurde zurückgezogen. Diese Verlängerung des Auslegers vergrößerte den Aktionsraum des Krans und erleichterte die Bauarbeiten. Der Autor schloss auch die Möglichkeit eines Tretradantriebes nicht aus.
Geschützbohrmaschine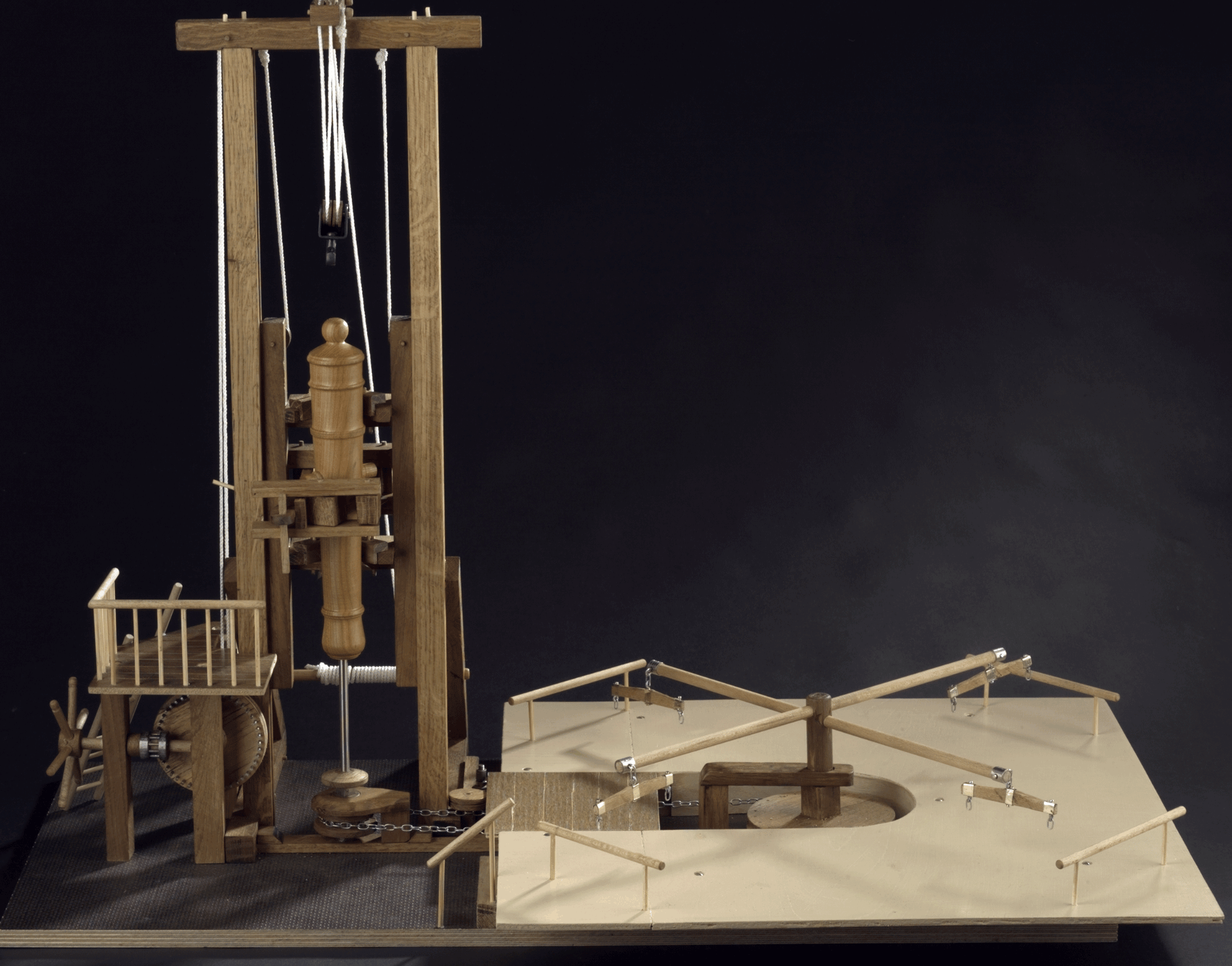 Nachbau einer Geschützbohrmaschine Zur Zeit Philipp Mönchs wurden die Geschützrohre aus Eisen oder Metall in rohen Formen aus Lehm gegossen. Teilweise kam dabei sicherlich bereits das Wachsausschmelzverfahren zum Einsatz. Jedes Stück wurde individuell geformt. Erst mit den meist landesherrlich geförderten Gusshütten, die gegen Beginn des 16. Jahrhunderts entstanden, traten erste Ansätze einer rationellen Serienproduktion auf, die auch genormte Geschütztypen hervorbrachten. Doch auch in solchen protoindustriellen Produktionsformen war nach dem Guss der Geschütze noch Nacharbeit erforderlich. Für einen präzisen Schuss war dabei vor allem ein gleichmäßig gegossenes Rohr mit einer möglichst präzise gearbeiteten Seele verantwortlich. Während in der Anfangsphase der großkalibrigen Feuerwaffen die relativ kurzen Läufe der Büchsen noch aus einzelnen Stäben zusammengeschmiedet wurden und die notgedrungen auftretenden Toleranzen durch zwischen Ladung und Kugeln eingepasste Holzscheiben und Verdämmungen ausgeglichen wurden, war dies am Ende des 15. Jahrhunderts nicht mehr möglich. Die Geschützläufe waren nun, um einen präziseren und weiteren Schuss zu erzielen, erheblich länger geworden, so dass ein Verdämmen der Kugel mit Holzklötzen oder Strohkränzen kaum noch praktikabel war. Da jedoch jeder Spalt zwischen Geschoss und Geschützwandung die Pulvergase ungenutzt entweichen ließ und auch die meist noch aus Stein gehauenen Kugeln kleinere Toleranzen aufwiesen, war es nötig die roh gegossenen Rohre auf einen präzisen Durchmesser zu bohren. Das Modell versteht sich nicht als Versuch, die Geschützbohrmaschine Philipp Mönchs präzise zu rekonstruieren. Vielmehr wurden einige seiner Ideen aufgenommen, weitergeführt und mit anderen zeitgenössischen Techniken kombiniert, welche im Verlauf des 16. Jahrhunderts weiter verfeinert wurden. In den landesherrlichen Gusshütten des 16. Jahrhunderts könnten derart rationell betriebene Geschützbohrgestelle jedoch tatsächlich gestanden haben. Im Falle eines gut rekonstruierbaren Kanonenbohrturms in Augsburg lassen sich einige Elemente der Konstruktion in Funktion und Ausmaßen auch nachvollziehen. Die Kraft für den hier aufrecht stehenden Bohrer wird durch einen Pferdegöppel erzeugt, der neben dem eigentlichen Bohrgestell liegt. Die Kraft wird durch eine Kette auf das Bohrfutter übertragen und dabei untersetzt. Gegen Durchdrehen wird die Kette mit einem Kettenspanner gesichert. Damit konnten erhebliche Momente übertragen werden. Am oberen Ende des Bohrgestells wurde noch der Ausleger für einen Flaschenzug angebracht. Solche Flaschenzüge sind in anderen Maschinen Mönchs, etwa in zahlreichen Hebebäumen, als Teil der alltäglichen Hebetechnik regelmäßig abgebildet. Mit seinen doppelten Seilrollen zusammen mit einer Haspel, die am hinteren unteren Stützbalken des Bohrturms angebracht ist, konnten tonnenschwere Rohre ohne große Mühe in die Spannvorrichtung des Werkstücks gehoben und nach dem Bohren wieder heruntergelassen werden. Dazu wurde vermutlich einfach eine Gleitbahn an das Gestell angelegt.
Enterbrücke
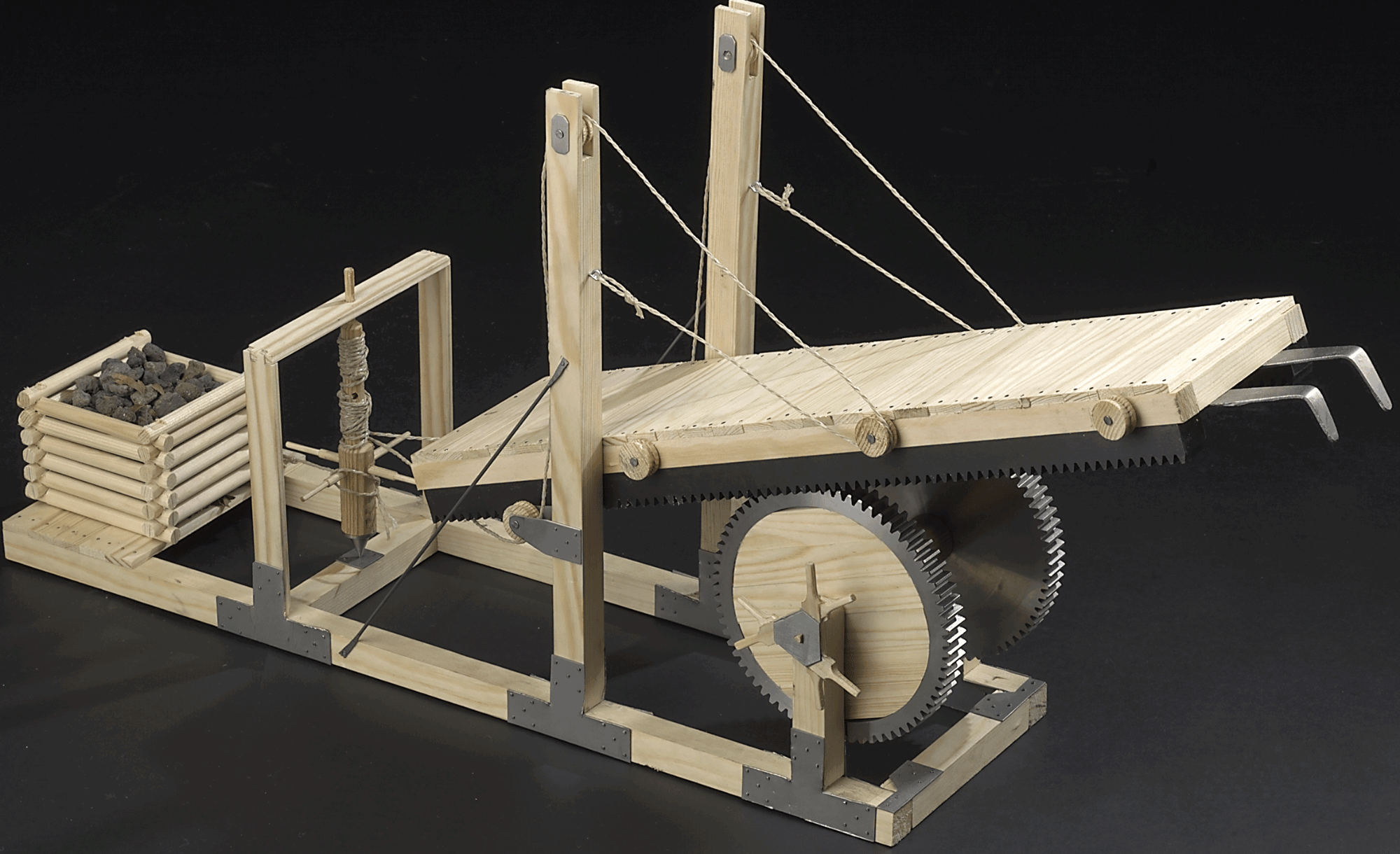 Nachbau der Enterbrücke cpg 126; 16v 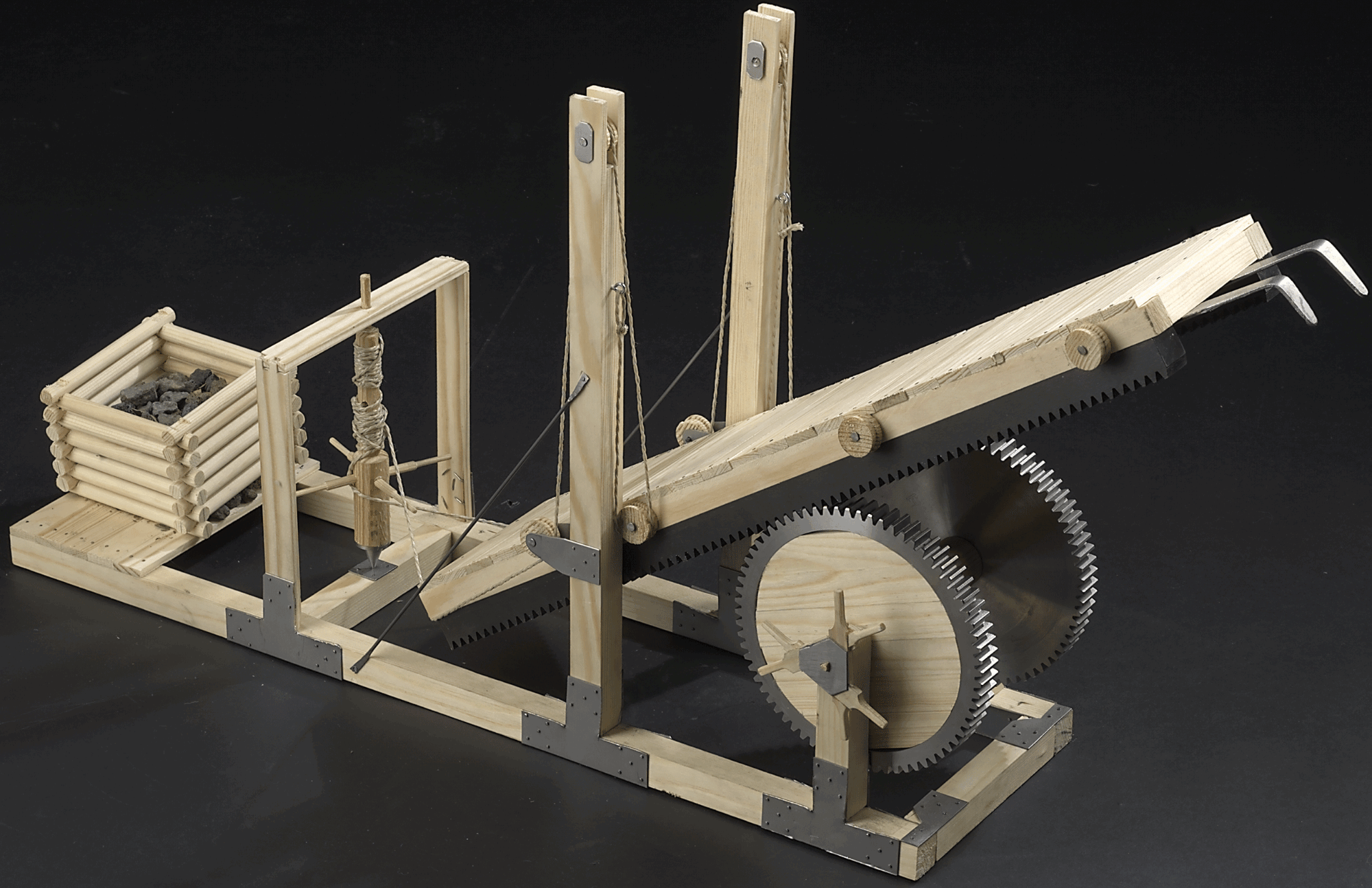 Die von Philipp Mönch auf fol. 16v gezeigte Enterbrücke soll vor allem beim Erstürmen von Festungen zum Einsatz kommen, wo Mauern unterschiedlicher Höhe überwunden werden müssen (siehe links). Neben dem militärischen Zweck ist es denkbar, dass eine bereits bestehende Enterbrücke zur Überwindung von Gewässern oder Gräben genutzt werden kann. Einfachere Zugbrücken waren bereits lange bekannt und wurden schon auf See von den Römern gegen Karthago sowie auf dem Land im Hochmittelalter eingesetzt. Spätestens seit den Kreuzzügen sind verschiedene Kriegsmaschinen (z. B. Wandeltürme oder Ebenh&öhen ) überliefert, die an die Mauern herangeschoben wurden; über herunterklappbare Brücken verschafften sich die Soldaten Zugang zur Festung. Diese Türme sind auch in den Italien-Feldzügen Friedrich Barbarossas beschrieben. Abbildungen dieser Maschinen sind dagegen erst aus dem späten Mittelalter bekannt, so bei Konrad Kyeser im Bellifortis (um 1405) oder Roberto Valturio in De re militari (um 1455). Diese Werke dienten als Vorlagen für die zahlreichen Büchsenmeisterbücher, die im deutschsprachigen Raum im 15. Jahrhundert entstanden. Dort finden sich alle bekannten Varianten solcher Belagerungsmaschinen. Philipp Mönch übernimmt bei seinem Entwurf die meisten Elemente dieser Belagerungsmaschinen. Wie bei den üblichen Zugbrücken ist am beweglichen Ausleger ein Seil in einer Umlenkrolle eingehängt. Dieses Seil ist einerseits an einem hohen Pfosten befestigt, andererseits läuft es über diesen Pfosten hinunter zu einer Haspel, die von mehreren Soldaten bedient wird. Die Innovation besteht darin, an den Längsseiten des Auslegers Zahnstangen zu befestigen und ihn auf Zahnrädern zu lagern. So kann neben der Elevation – durch Auf- und Abrollen des Seils – auch die Länge der Enterbrücke – durch Drehen der Zahnräder – eingestellt werden. |
|